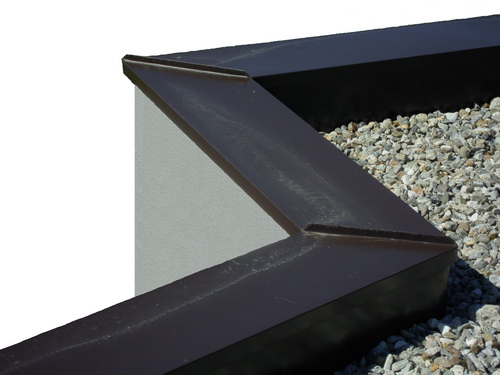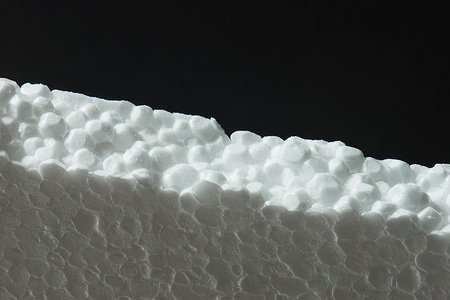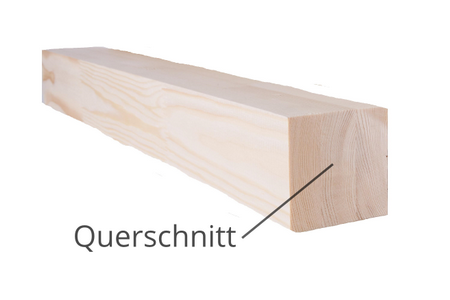Begriffserklärungen
A
-
Abnahme
Konstruktionen, die auf Basis von statische Berechnungen ausgeführt wurden (Stahl-, Stahlbeton- und Holzkonstruktionen), werden nach Bauende durch einen weiteren Ingenieur (andere Person als der Statiker) abgenommen bzw. “kollaudiert”. Dieser stellt somit den Abnahmebericht (collaudo statico) aus.
-
Abschreibung
Steuerliche Maßnahme, bei der die für das Unternehmen notwendigen Ausgaben (z.B. Löhne der Arbeitnehmer, Materialspesen, …) im gleichen Jahr oder auf mehrere Jahre verteilt, ganz oder teilweise, von den Einnahmen abgesetzt werden können.
-
Abstandhalter
Bauteil oder Hilfsgegenstand, um einen vorgeschriebenen Abstand während der Bauausführung zu gewährleisten (z.B. bei Schalungsarbeiten, um die gewünschte Wandstärke bei Betonstärke zu erzielen oder um eine vorgegebene Distanz zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche einzuhalten)
-
Abwasser
Bezeichnung für verbrauchtes Wasser oder Regenwasser, welches durch ein Abwasserrohr abgeleitet wird.
Schmutzwasser => Schmutzwasserleitung
Regenwasser => Regenwasserleitung
Schmutzwasser + Regenwasser => Mischwasserleitung -
Achsabstand
Abstände, gemessen zwischen den Achsen zweier Bauteile. In der Regel liegt die Achse in der Mitte der Bauteile.
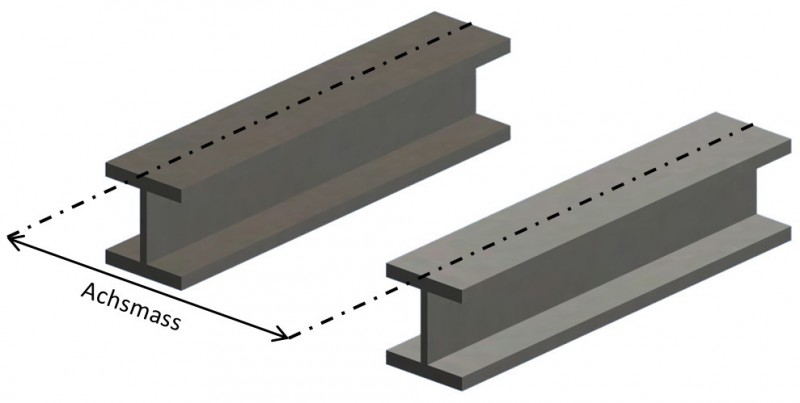
-
Amortisierung
Wirtschaftliche Ausdrucksweise einer zeitabhängigen Kostenabdeckung, bis die Kosten einer Investition (z.B. eines Werkzeuges, einer Maschine oder einer Installation) wieder eingegangen sind
-
Anschlussbewehrung
Findet Anwendung, wenn zeitlich unterschiedlich hergestellte Betonierabschnitte statisch miteinander verbunden werden müssen. Die industriell gefertigte Anschlussbewehrung wird dabei in den ersten Betonierabschnitt eingelegt; nach dem Ausschalen wird die darin enthaltene Bewehrung aufgebogen, um diese in den zweiten Betonierabschnitt einbinden zu können (z.B. Frank Stabox®)
-
Ansicht
Horizontale, zeichnerische Darstellung/ Sicht einer Objektseite. Bei Bauwerken sind dies die Fassadenansichten, welche mit den vier Himmelsrichtungen bezeichnet werden.
-
Anzahlung
Teilzahlung der gesamten Auftragssumme, welche vor oder während der Leistungserbringung getätigt wird (je nach Vereinbarung zwischen Bauherr und Dienstleister bzw. ausführendem Unternehmen)
-
Arbeitsfuge
Ausführungsbedingte Trennflächen, welche bei Betonierarbeiten auftreten, sobald ein Bauteil in mehreren Betonierschritten angefertigt wird.
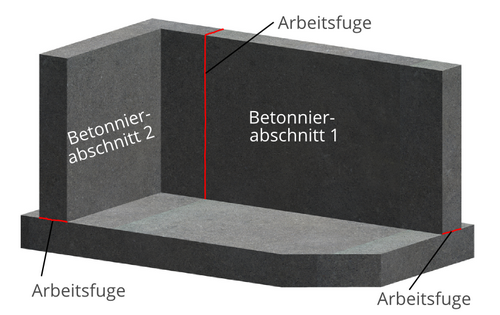
-
Asbest
Häufig verwendetes, nicht brennbares Baumaterial aus Mineralfasern aus den 1970/80er Jahren. Aufgrund der nachgewiesenen Krebserkrankungen, ausgelöst durch das Einatmen des Asbeststaubes, ist die Anwendung seit mehreren Jahren verboten. Sollte Asbest bei Abbrucharbeiten festgestellt werden, ist unverzüglich ein spezialisiertes Unternehmen für den Abbruch und die Beseitigung zu beauftragen.

-
Aufbeton
Betonschicht, um die gewünschte Höhe eines Betonbauteiles herzustellen (z.B. auf den Treppenstufen, da die Herstellung der exakten Höhe in der Betonierphase der Treppen schwierig ist)

-
Aufputz-Installation
Installationsleitungen, welche sichtbar an Decken und Wänden verlegt werden (z.B. im Keller, in landwirtschaftlichen Garagen, Hallen, Werkstätten usw.). Das Gegenteil davon ist die Unterputzinstallation.

-
Aufsparrendämmung
Verlegung als durchgehende Dämmschicht oberhalb der Sparren.
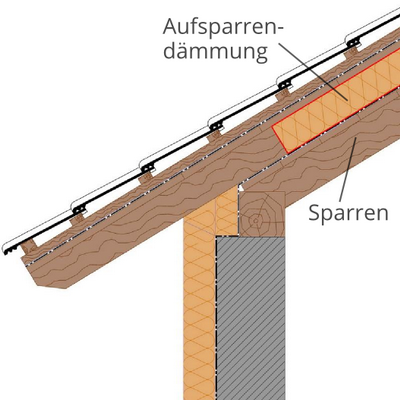
-
Auftragsbestätigung
Mündliche oder schriftliche Auftragsvergabe einer Dienstleistung bzw. einer Bauausführung. Die Auftragsbestätigung basiert in der Regel auf einem schriftlichen Angebot. Eine detaillierte Form der Auftragsbestätigung kann in Form eines Werkvertrages erfolgen.
-
Ausbau – Ausbauarbeiten
Arbeiten im Inneren eines Gebäudes folgend auf den Rohbau (z.B. Installationen, Putz-, Estrich- und Malerarbeiten, Boden- und Fliesenverlegungsarbeiten bis hin zu Einrichtung des Gebäudes)
-
Außenmaß
Abstand zweier Punkte, gemessen an den Außenkanten zweier Baukomponenten
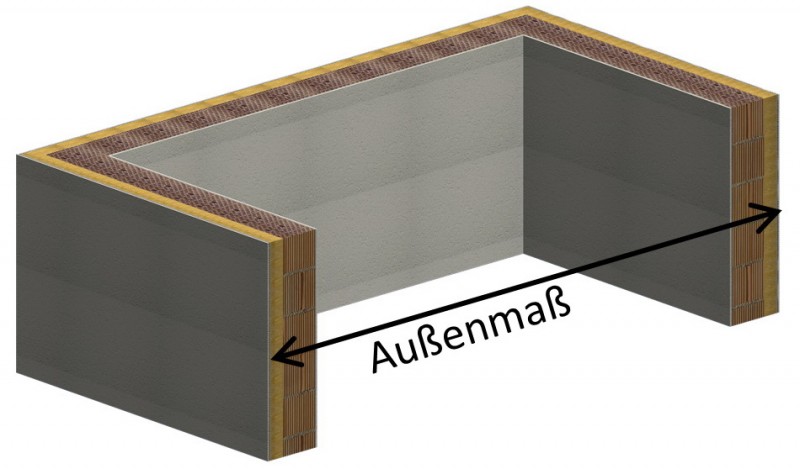
-
Ausführungsplan
Detaillierter Plan zur Ausführung an der Baustelle, der alle notwendigen Informationen für jegliche ausführenden Unternehmen (umgangssprachlich auch 50er-Pläne genannt) beinhaltet. Der Ausführungsplan gibt Auskunft über genaue Abmessungen, die Beschreibung der Wand- und Deckenaufbauten inkl. aller Schichtstärken, den Verlauf von Steigleitungen und Abflussrohren, Angaben zu Durchbrüchen, Details zu den Lichtöffnungen, Gefälle uvm.

-
Ausgleichsbeton
Guss einer Leichtbetonschicht mit geringer Baufestigkeit für die Herstellung einer nahezu ebenen Oberfläche, z.B. auf Decken, Abflussrohren und Rohrleitungen der Thermo-Sanitären Anlagen und Leerrohren der Elektroinstallationen, als Schutz gegen Beschädigung der Rohre und Vorarbeit zu den Estricharbeiten
-
Auskragung
Vorspringendes oder hinausragendes Bauteil, z.B. Balkon, Gebäudevorsprünge, Vordächer, usw.rdächer, usw.
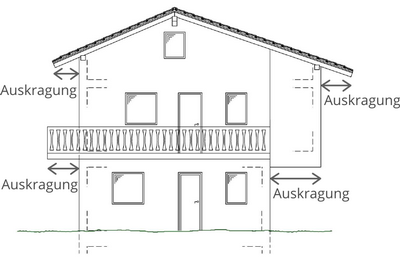
-
Ausschalen
Entfernen der Schalungen, welche zum Betonieren von Bauteilen aufgebaut wurden
-
Ausschreibung
Dokument zur Vorlage an die anbietenden Dienstleister oder ausführenden Unternehmen , welches die erforderlichen bzw. gewünschten Leistungen im Detail beschreibt (was, wann, wie viel)
-
Aussparung
Planmäßig vorgesehene Eintiefung oder Schlitz in Wand, Decke oder Beton (z.B. für Elektro-, Thermo-Sanitäre Leistungen bzw. Anlagen oder Fensteröffnungen)
B
-
Balken
Runder oder rechteckiger, länglicher horizontal verlaufender Bauteil. Ähnliche Bauteile aus Stahl oder Stahlbeton werden als Träger bezeichnet.

-
Balkendecke
Zwischendeckenkonstruktion in Holzbauweise, bestehend aus Kant- oder Brettschichthölzern, verlegt im vorgesehenen Achsabstand (z.B. 80cm). Der Hohlraum zwischen den jeweiligen Holzbalken wird mit Holzbrettern oder Trockenbauplatten geschlossen.
-
Balkenschuh
Bauteil, meist aus Stahlblech, zur Auflage und Befestigung der Holzbalken an andere Holzbauteile oder Wände (z.B. Pfetten an Rahmenbinder oder Sparren/ Pfetten an einer Stahlbetonwand)

-
Balkontrennelement
Industriell gefertigtes Bauteil zur thermischen Trennung von Stahlbetonbalken zu den Stahlbetondecken oder -wänden, welches somit eine Wärmebrücke verhindert, umgangssprachlich oft mit dem Handelsnamen Isokorb (Schöck) bezeichnet. Das Trennelement besteht hauptsächlich aus einer Dämmschicht und einer durchgehenden Rundstahlbewehrung.
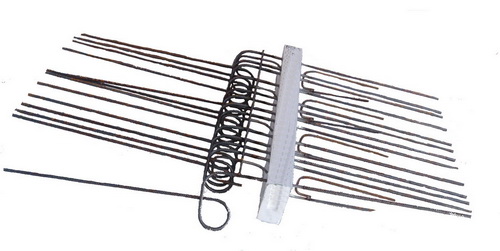
-
Baufeuchte
Vorhandene Feuchtigkeit im Bauobjekt, welche auf die Bauausführung zurückzuführen ist (z.B. Wasser im Beton, Mörtel, Verputz und/ oder Estrichen)
-
Baugrubensicherung
Maßnahme zur Sicherung von Baugruben, um die Stabilität von Aushubböschungen zu gewährleisten bzw., um die Baugrube vor Steinschlägen oder Hangrutschen zu sichern (z.B. Steinschlagschutznetze, Spritzbeton- Nagelwände, Bohrpfahlwände uvm.)
-
Bauleitplan
Gemeindebezogene grafische Planunterlagen welche die landschaftlichen und baulichen Massnahmen, zwecks geordneter Dorf-, bzw. Stadtentwicklung regelt. Anhand dieses Dokumentes erkennt der Bauherr bzw. der Projektant was auf die jeweilige Parzelle gebaut werden kann.
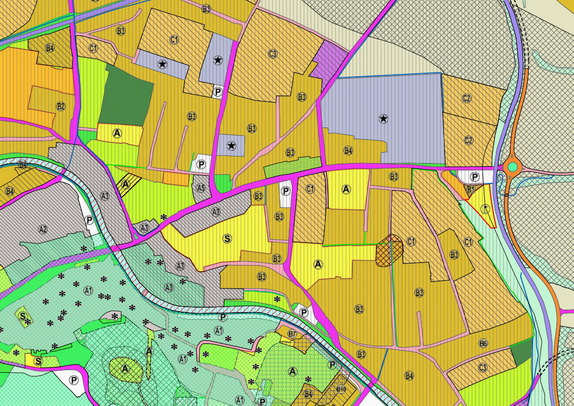
-
Baulos
Definierter Bauabschnitt eines größeren, gesamten Bauvorhabens
-
Baunebenkosten
Auftretende Kosten, welche bei einem Bauvorhaben anfallen, die nicht direkt mit den Bauausführungen oder Dienstleistungen in Zusammenhang stehen, z.B. Grundstückspreis, Steuern, Gebühren, Notarspesen uvm.
-
Baustahlmatte
Bewehrungsmatte, bestehend aus gerippten Rundstäben verschiedener Durchmesser, in gleichmäßiger Gitterform zusammengeschweißt (umgangssprachlich auch als Netz bezeichnet)
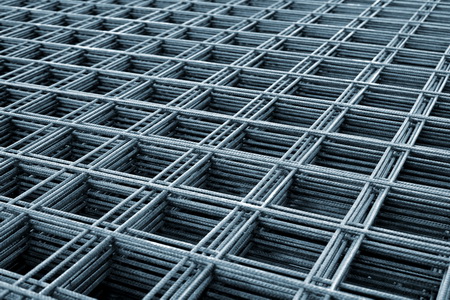
-
Bauzaun
Provisorische Abgrenzelemente für die Umzäunung einer Baustelle. Bauzäune können in unterschiedlichen Formen und Materialien vorkommen, z.B. Metallgitter, Kunststoff, Holz oder Beton. Die Höhe ist abhängig von der Art der Baustelle, liegt jedoch zwischen 1,20m und 2,00m (mit oder ohne Sicht- und Schutznetz).
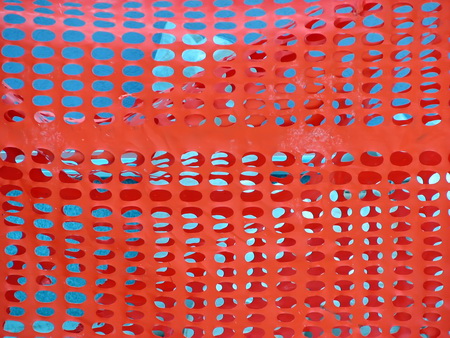
-
Bestandszeichnung
Planunterlagen, welche den aktuellen Zustand und die Abmessungen eines Gebäudes darstellen
-
Bewehrung
Bezeichnung für die in Stahlbetonbauteilen verlegten, gerippten Stahlstäbe (können gerade oder gebogen sein)

-
Blähton
Kugelförmige Gebilde mit einem Durchmesser bis ca. 40mm aus kalkarmem Ton. Wird als Zuschlagsstoff für Leichtbeton verwendet (z.B. für Ausgleichs- Isobeton). Bekannt ist Blähton auch als Substrat für Zimmerpflanzen.

-
Blechwand
Mit Metallblechen verkleidete Wand.

-
Blindstock
Metall- oder Holzrahmen, die in der Rohbauphase in Fenster- und Türöffnungen eingebaut werden. Für die endgültige Montage der Fenster und Türen gewähren die Rahmen einen trag- und montagefähigen Untergrund.

-
Blockbauweise
Massivbauweise im Holzbau, in welcher Kant- oder Rundhölzer waagerecht übereinander geschichtet werden. Die Ecken werden durch abwechselnde, ober-/ unterseitige Auskerbungen gebildet.

-
Blockziegel
Großformatiger, herkömmlicher Mauerziegel, welcher im Unterschied zum Planziegel an der Stand- bzw. Auflagefläche nicht plangeschliffen ist.
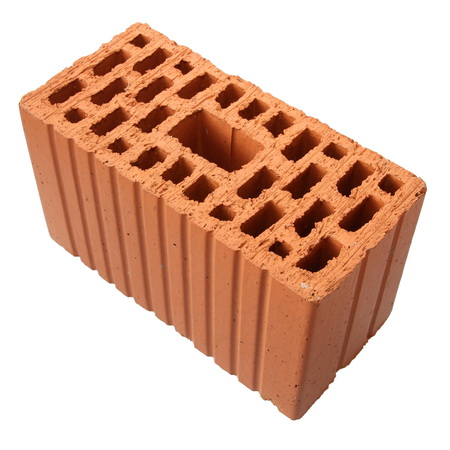
-
Bodenaufbau
Summe aller notwendigen Schichten ab der Fundament- oder Deckenoberkante. Der Bodenaufbau bildet je nach Notwendigkeit die Summe aus der Dämmschicht, den Installationen, der Ausgleichsschicht, der Trennlage oder der Trittschalldämmung, der Fußbodenheizung, dem Estrich und dem Bodenbelag.
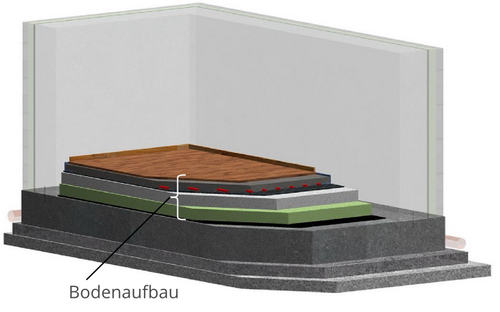
-
Brandschutztür
Spezielle Türen für den Innen- oder Außenbereich, die im Brandfall unterschiedliche Bereiche voneinander trennen und das Ausbreiten von Feuer und Rauch verzögern bzw. verhindern.

-
Brettschichtholz
Mehrschichtige Holzbauteile, wobei die (mindestens drei) Schichten alle in die gleiche Richtung miteinander verleimt werden, kurz BSH oder Leimbinder genannt.

-
Brettsperrholz
Mehrschichtige Holzbauteile, bei denen die Holzschichten untereinander kreuzweise verleimt oder gedübelt sind, auch als mehrschichtige Massivholzplatte oder X- Lam bezeichnet.

-
Brüstung
Begrenzung eines Balkons, einer Terrasse usw. in Form eines Geländers, einer Mauer oder ähnlichemm.
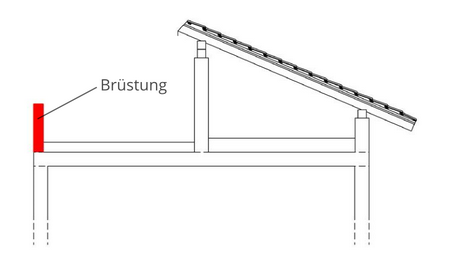
-
Bruttowohnfläche
Gesamtheit aller innerhalb der Wohnung liegenden Flächen (Wohnräume, Nebenräume, Gänge, Treppen) zzgl. der Wandquerschnitte, jedoch ohne die außerhalb liegenden Flächen, wie Treppenhäuser, Terrassen und offene Balkone sowie nicht bewohnbare Keller- und Dachgeschossräume
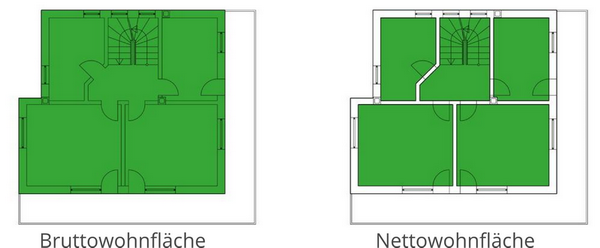
D
-
Dachaufbau
Summe aller Schichten, die das Dach bilden (Tragschichten, Dämmschichten bis hin zur fertigen Dachdeckung)
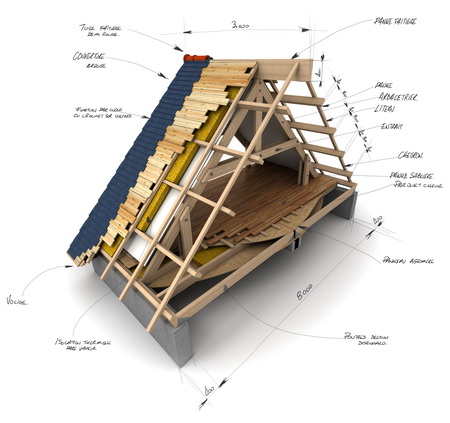
-
Dachdeckung
Oberste Lage eines Dachaufbaus, die der Witterung ausgesetzt ist (z.B. Blechabdeckung, Ziegelsteine, Tonplatten, Bitumenplatten, Holzbretter, Schindeln, usw.)

-
Dachdurchdringung
In der Dachfläche vorgesehene Öffnungen oder Aussparungen, z.B. Dachfenster, Schornsteine, Entlüftungsrohre, Dachantennen, usw.
-
Dachformen
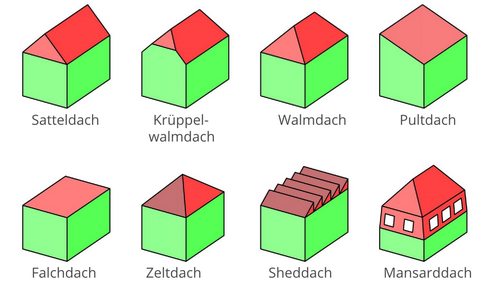
-
Dachgaube
Dachzubau bei geneigten Dächern, welcher der Belichtung und Belüftung der Dachräume dient sowie eine Erhöhung der Raumhöhe zur Folge hat

-
Dachhaken
An der Dachkonstruktion befestigte Anschlagpunkte als punktuelle Sicherheitsvorrichtungen für die Ausführung von Kontroll- und Wartungsarbeiten am Dach
-
Dachlattung
Die Dachlattung wird auf der Konterlattung vorgesehen und trägt die Dachdeckung (Dachplatten). Auch bei Verkleidungen werden Lattungen angebracht, welche als ebener Befestigungsuntergrund dienen. Außerdem entsteht mit der Lattung die evtl. notwendige Installationsebene.

-
Dachstuhl
Tragende Konstruktion des Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten, First, Streben, Verbänden und Stützen

-
Dachzaun
Während der Bauausführung am Dachrand befestigte, provisorische Schutzgeländer als Sicherheitsvorrichtung gegen den Absturz vom Dach für Mensch, Maschinen und Materialien

-
Dampfbremse
Diffusionsoffene (= atmungsaktive) Folie für Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen, die eine bestimmte Durchlässigkeit von Wasserdampf ermöglicht. Die Durchlässigkeit ist abhängig von der Größe der Poren in der Folie.
-
Dampfsperre
Diffusionsdichte (= nicht atmungsaktive) Folie für Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen, welche keinen Wasserdampf durchlässt (z.B. Nylon (PE-Folie))
-
Darlehen
Kredite mit langfristiger Laufzeit ab ca. 10 Jahren. Finanzierungen für den Bau von Wohngebäuden und landwirtschaftlichen Gebäuden, diese werden in der Regel in Form eines Darlehens gestaltet.
-
Deckenbündiger Träger
Ein in der Decke bündiger Träger, der nicht nach oben oder unten hervorsteht und damit auch nicht sichtbar ist
-
Deckenheizung
In der Deckenunterseite eingebaute Heizelemente (Flächenheizung)
-
Detailzeichnung
Planunterlage für die genaue, detaillierte Darstellung eines Bauteils bzw. eines Ausführungsdetails inkl. der Angabe der Schichtstärken, Materialien, Farben usw. Der Maßstab wird geeignet dazu gewählt, im Bauwesen 1:50, 1:25, 1:10.
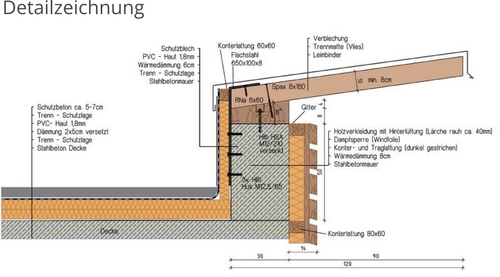
-
DHF-Platten
Diffusionoffene und feuchtbeständige, verleimte Holzfaserplatten, die für die äußere Beplankung von Wänden und Dächern verwendet werden

-
Diffusionsdicht
nicht atmungsaktiv; lässt keinen Austausch von Wasserdampf zu
-
Diffusionsoffen
atmungsaktiv; lässt einen bestimmten Wasserdampfaustausch zu
-
Dispersionsfarbe
Handelsübliche, zähflüssige Anstriche (Wandfarben), welche aus einer chemischen Dispersion (meist Emulsionen), aus Füllstoffen, Bindemitteln und Farbpigmenten bestehen.
-
Doppelte Ecken
Normalerweise werden auf den Planunterlagen immer die Aussenkanten bemasst (siehe Abb. 1). Werden jetzt bei der Volumsberechnung diese Werte angenommen, werden die Ecken doppelt gerechnet. Um dies zu vermeinden haben Sie zwei Möglichkeiten: zum Einen können Sie das Achsmaß (Mittellinie) herausmessen (Abb. 2) und mit der Bauteilstärke multiplizieren, oder Sie messen die einzelnen Bauteillängen (Abb. 3) heraus und addieren diese und multipizieren das Ergebnis anschließend mit der Bauteilstärke
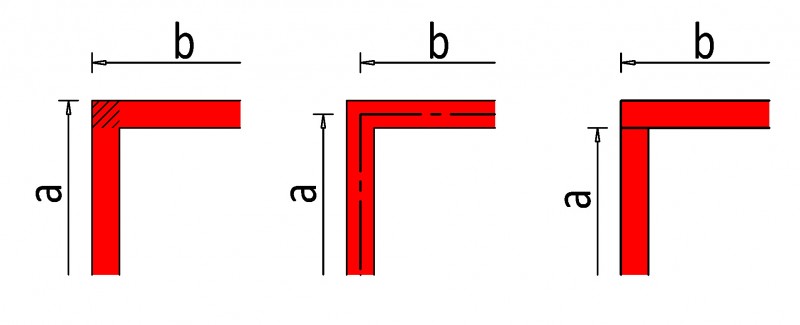
-
Drainage
Unterirdische Sammlung und Ableitung von vorhandenem bzw. zufließendem Grundwasser, um z.B. das Gebäude vor den Auswirkungen des Grundwassers zu schützen bzw., um nasse Böden zu entwässern
-
Durchbruch
Kleinere Öffnungen in Decken und Wänden als Durchgang für Installationen.
-
Durchstanzen
Form des Versagens von Stahlbetonplatten, wie z.B. Decken oder Fundamentplatten. Die Gefahr des Durchstanzens entsteht in Punkten hoher einzuleitenden konzentrierten Kräfte auf einer „zu dünnen“ Stahlbetonplatte bzw. –decke. Bei Überschreitung der zulässigen Lasten versagt die Stahlbetonplatte in einem kreisförmigen Schnitt rund um die Stütze. Die Stütze drückt sich bzw. “stanzt” durch die Platte oder Decke. Abhilfe kann eine größere Auflagerfläche (z.B. dickere Stütze), eine dickere Stahlbetondecke oder der Einsatz von Durchstanzbewehrung schaffen, auch umgangssprachlich Halfen bezeichnet.
-
DWD-Platten
Diffusionsoffene und winddichte Holzfaserplatten als Wand- und Dachplatten
E
-
Edelputz
Werksgemischter, mineralischer Oberputz (Feinputz) als Kalkzementmörtel für Innen- und Fassadenflächen. Bei stark bewetterten Außenflächen muss der Oberputz noch mittels Deckanstrich (z.B. Silikatfarbe) vor Witterungseinwirkungen geschützt werden.
-
Edelstahl
Legierte oder nicht legierte Stähle mit hohen Reinheitsgrad (z.B. rostfreier Stahl – INOX)
-
Einheit
Maß- oder Größeneinheiten im Bauwesen dienen als Bezeichnung für Längen, Flächen, Anzahl, Gewicht usw. (z.B. m, m², Stück, kg)
-
Einheitspreis
Bezeichnung für den Preis für eine Einheit der gewünschten Leistungen (z.B. €/m, €/m², €/Stück, €/kg)
-
Einzelfundament
Punktförmige Gründungsform unter punktuell auftretenden Lasten (z.B. unter Stützen)

-
Endabrechnung
Abrechnung der ausgeführten Arbeiten nach Fertigstellung der Bauarbeiten. Zu jedem Gewerk bzw. jeder Auftragserteilung gibt es die dazugehörige Endabrechnung.
-
Endzahlung
Letzte Zahlung einer Gesamtsumme, nach evtl. getätigten An- oder Teilzahlungen, zu den ausgeführten Dienstleistungen oder Bauarbeiten (Saldo)
-
EPS
Expandiertes Polystyrol, umgangssprachlich Styropor genannt; besteht aus aufgeschäumtem und in Form gebrachtem Polystyrolgranulat und hat eine grobporige Struktur

-
Estrich – Massivbauweise
Teil des Fußbodenaufbaus; Bezeichnung für die lastab tragende Schicht unter den Bodenbelägen. In der Massivbauweise wird der Estrich aus Zementmörtel (Zementestrich) hergestellt. Wird der Estrich sichtbar gelassen, ist er auch gleichzeitig die Nutzschicht bzw. der Bodenbelag (z.B. Industrieboden)

-
Estrich – Trockenbauweise
Trockenestrich ist ein Teil des Fußbodenaufbaus und bezeichnet die lastab tragende Schicht unter dem Bodenbelag (z.B. OSB- Platten, Hartholzfaserplatten, Zementfaserplatten, Gipsfaserplatten, usw.)
-
Extensive Begrünung
Form der Flachdachgestaltung. Als Gewächse gedeihen Moos- Sedum bis Gras- Kraut. Geringer Pflegeaufwand, Keine Zusatzbewässerung nötig. Extensive Begrünung ist nicht als Nutzfläche geeignet.

F
-
Faserbeton
Beton mit Zusatz von Fasern (meist Glas-, Stahl- oder Kunststofffasern). Der Beton erhält dadurch eine höhere Zugfestigkeit, Druckfestigkeit und es kann auf Biegung beansprucht werden.
-
Fassadengerüst
Vollflächige Baugerüste, montiert und befestigt an den Fassaden; dienen als Arbeitshilfe für Arbeiten an den Fassaden und als Schutz gegen den Absturz der Arbeiter

-
Fassadenplatten
Plattenförmige Verkleidungen, montiert an der Gebäudefassade; oft aus industriell gefertigen Pressplatten mit witterungsbeständigen Eigenschaft, die eine längere Lebensdauer haben

-
Fassadenverkleidung
Verkleidungen jeglicher Art und Materialien, die an der Gebäudefassade montiert werden (z.B. Holz, Metall, Kunststoffplatten, Natursteine, künstliche Steine usw.)
-
Feinputz
Letzte Putzschicht bei mehrlagigen Putzen; gibt der Oberfläche die sichtbare Struktur. Die Machart kann der Bauherr aus mehreren Varianten wählen (Putzträger, Grobputz, Fein- bzw. Oberputz)
-
Feng Shui
Fernöstliche Harmonielehre, welche die Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung als Ziel verfolgt. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Gestaltung und Ausrichtung der Wohn- und Lebensräume.
-
Fensterbank
Abdeckung der Fensterbrüstung an der Außenseite des Gebäudes

-
Fensterbrett
Abdeckung der Fensterbrüstung im Inneren des Gebäudes

-
Fensterladen

-
Fenstersprosse
Profile, um eine größere Fensterfläche in kleinere Glaselemente zu unterteilen

-
Fenstersturz
Ein von der Decke nach unten stehendes Element über den Wandöffnungen. Jede Wandöffnung besitzt einen Sturz, außer sie ist deckenbündig angelegt.
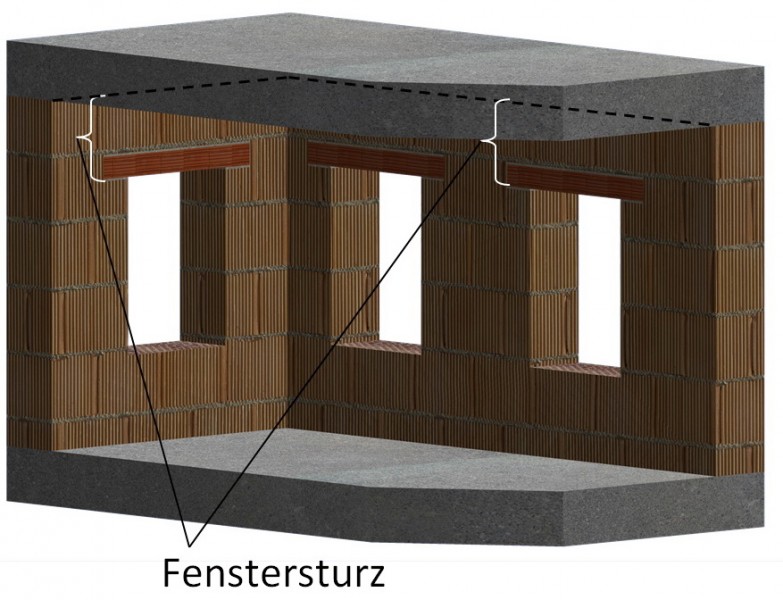
-
Fertigbauteil
Bauteil, welches im Werk vorgefertigt wird und auf der Baustelle lediglich montiert werden muss
-
Fertigparkett
Werksseitig vorgefertigte und versiegelte Parkettbeläge, die mit Nut und Feder versehen sind und nach dem Verlegen nicht mehr abgeschliffen werden müssen.

-
Fertigputz
Industriell vorgefertigte Putzmischung, die gleich aufgetragen werden kann
-
Feuchtraum
Räume mit konstanter Luftfeuchtigkeit höher als 70% (z.B. Sauna, Schwimmbäder, Duschen in Sportstätten, usw.)
-
Feuerverzinkung
Verfahren, bei der Stahlbauteile mit einer Zinkschicht mittels Eintauchen in einem Zinkbad überzogen werden. Diese Schicht verleiht den Stahlbauteilen eine korrosionsbeständige, langlebige Oberfläche.

-
FI-Schutzschalter
Sicherheitskomponente in der Elektroinstallation gegen den Stromschlag, die evtl. auftretende Differenzströme misst, wenn z.B. schadhafte Isolierungen vorhanden sind.
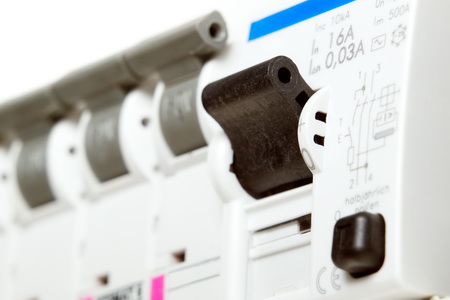
-
Filterstein
Hochloch- Betonziegel, der das anfallende (nicht stauende) Grundwasser vertikal nach unten in die/ das Drainageschicht/ -rohr umleitet, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Filtersteine weisen einen guten mechanischen Schutz der weiteren Abdichtungs- und Dämmschichten auf. Sie gehören zu den vertikalen Abdichtungsbauteilen für unterirdische Kellerwände.

-
First
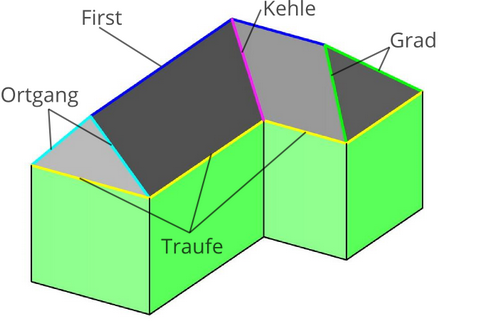
-
Fließestrich
Estrich, der sich aufgrund seiner Zusammensetzung und Zusatzmittel fast von selbst ausbreitet

-
Frost
Temperaturen unter der Gefriergrenze.
-
Frosttiefe
Tiefe, welche der Frost in den Wintermonaten max. erreichen kann. Als Richtwert kann die Höhenlage geteilt durch 1000 angenommen werden, z.B. 1400m.ü.M. = Frosttiefe 1,40m. Die Errichtung eines Gebäudes sollte immer in frostfreier Tiefe liegen.
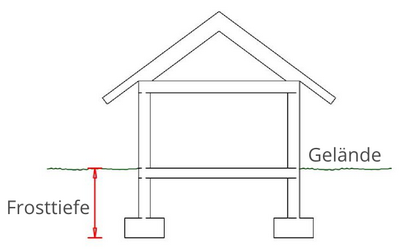
-
Füllbeton
Beton mit geringer Festigkeit zum Füllen größerer Hohlräume oder, um Böden aufzuhöhen, wenn die Schichtdicke relativ groß ist. Füllbeton ist nicht für statisch relevante Bauteile geeignet.
-
Fundament
Gründungselement eines Bauobjekts (z.B. Plattenfundament, Streifenfundament, Einzelfundament)
-
Fundamentdämmung
Dämmplatten, die unter dem Plattenfundament verlegt werden. Sie müssen den Druckbeanspruchungen des darauf lastenden Gebäudes standhalten.
Bodendämmung wird hingegen auf die Fundamentplatte verlegt. -
Fußbodenheizung
Im Boden bzw. Estrich verlegte Heizelemente, bestehend aus mit Wasser gefüllten Rohren, die eine Vorlauftemperatur von 30°-35° besitzen; alternativ im Estrich verlegte Heizmatten

G
-
Gasbeton
Mineralischer, dampfgehärteter Baustoff , auch als Porenbeton bezeichnet, der als verschiedenförmige Platten und Steine künstlich hergestellt wird

-
Gebäudetechnik
KNX, EIC und BatiBus steht für Gebäudetechnik bzw. Steuerungstechnik für Gebäuden.
KNX-Standard ist der Nachfolger von EIC, und ist der aktuelle Standard für Gebäudetechnik. KNX und EIC sind untereinander kompatibel.
Gebäudetechnik bedeutet das die Steuerfunktionen und die Energieverteilung voneinander getrennt ist.
Mit KNX können Sie Ihre Stromverbraucher über Bedienfeld, PC oder Handy steuern und verwalten.
-
Gefälle
Angabe der Neigung einer Oberfläche in % (1% = 1 Teil von 100; kann 1cm von 100cm, aber auch 1m von 100m bedeuten)
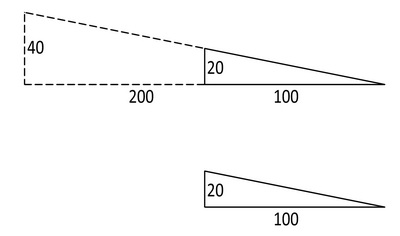
-
Gefällebeton
Bewehrte oder unbewehrte Betonschicht, welche eigens dafür vorgesehen wird, einem Betonbauteil das notwendige Gefälle zu verleihen, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Alternativ dazu kann ein Betonbauteil bereits bei der Herstellung mit Gefälle betoniert werden, so lässt sich der nachträgliche Gefällebeton vermeiden.
-
Geotextile Matten
Ist der Oberbegriff für verschiedenste Matten, meistens aus Vlies und Kunststoff oder kombiniert, welche im Erdbau zum Einsatz kommen um zu trennen, filtern, schützen, bewehren, dränen, verpacken und dichten. Teilweise kann ein und diesselbe Matte mehrere der genannten Eigenschaften erfüllen.
-
Gespundete Bretter
Bezeichnung einer Holzverbindung mittels Nut und Feder. Perlinen haben z.B. eine Nut und eine Feder und die Verlegung erfolgt somit mittels Spundverbindung.

-
Gipskartonplatte
Platte aus Calciumsulfat mit einem beidseitigen Kartonagebezug, welcher die Zugkräfte aufnimmt.

-
Gipskartonwand
In Trockenbauweise hergestellte Trennwand, bestehend aus einer Ständerkonstruktion (aus Aluminium oder Holz), versehen mit einer beidseitigen Einfach- oder Doppelbeplankung aus Gipskartonplatten
-
Gitterrost
Zu einer Gitterform verschweißte und verzinkte Flach- und Rundstäbe aus Stahl, welche z.B. als Abdeckungen von Lichtschächten Anwendung finden

-
Glasbausteine
Bauteile aus gepresstem Glas, die in horizontaler Anordnung für den Lichteinfall mit Sichtdämmung sorgen. Vertikal verlegte Bauteile werden als Betongläser bezeichnet. Sie werden auch als Glassteine bezeichnet.

-
Grabenaushub
Aushub mit vorgesehenem, schmalem Querschnitt zum Verlegen von z.B. Leerrohren, Trinkwasser- oder Abwasserleitungen, usw.

-
Gratsparren
Kantholz bzw. Pfette, welche entlang der Schnittkante (Grat) zweier schräger Dachkanten verläuft (z.B. beim Walmdach)
-
Grobputz
Dickere Schicht beim mehrlagigen Putz. Mit dem Grobputz lassen sich Unebenheiten ausgleichen.

-
Großflächenschalung
Gussform für den Ortbeton/ Lieferbeton. Die Großflächenschalung hat ggü. den normalen Schalbrettern (z.B. 4,0m x 0,2m) und den Schaltafeln (z.B. 3,0m x 0,5m) eine größere Abmessung (z.B. 2,7m x 2,4m)

-
Grundierung
Vorbehandlung von Untergründen, in der Regel, um die Haftung von nachfolgenden Schichten auf der Grundlage zu verbessern (z.B. Grundierung als Vorbehandlung für Anstriche oder auf Betonoberflächen als Putzträger)
-
Grundriss
Zeichnerische, maßstäbliche Darstellung eines horizontalen Schnitts durch das Bauvorhaben ( Ansicht von oben)
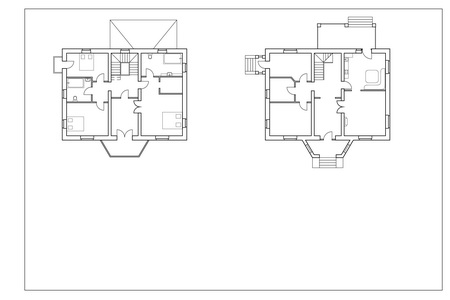
H
-
Haftbrücke
Schicht zwischen zwei weiteren Schichten, um die Haftung dieser Schichten untereinander zu gewährleisten (siehe auch Grundierung)
-
Heizestrich
Mineralischer Estrich- Bodenaufbau, der mit Heizungsrohren versehen ist. Der Estrich wirkt zusammen mit den Heizungsrohren als Heizkörper.

-
Heizkreis
Teil der Heizungsinstallation und meint den Kreislauf ab dem Heizkreisverteiler zu den Heizkörpern und zurück. Mehr Heizkreise bedeuten eine flexiblere Regelung der Heizung in den einzelnen Räumen.
-
Heizkreisverteiler
Beginn der unterschiedlichen Heizkreise. Meist wird pro Stockwerk ein Verteiler vorgesehen. Sind sowohl Heizkörper, als auch Fußbodenheizungen vorhanden, braucht es je einen Verteiler.
-
Hinterlüftung
Hinterlüftung eines Wand- oder Dachaufbau zwischen den Schichten. Dabei wird die von innen austretende Feuchtigkeit vor den duffusionsdichten Schichten abgeführt. Die Hinterlüftung befindet sich zwischen der Dämmschicht und der regendichten Außenschicht.
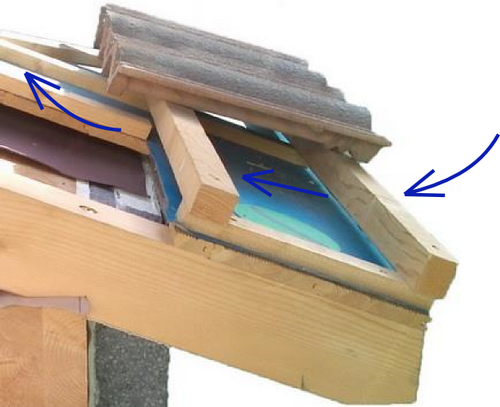
-
Hochlochziegel
Gelochter Ziegelstein, bei dem die Löcher senkrecht zur Standfläche verlaufen

-
Hohldielendecke
Bewehrtes, vorgespanntes Betonfertigteil für den Deckenbau, wo sich zwecks Gewichtersparnis Hohlräume im Deckenkern befinden. Diese finden bei großen Spannweiten in Industriehallen und (landwirtschaftlichen) Garagen Verwendung und können ohne Unterstützung verlegt werden. Im Wohnungsbau finden sie weniger Anwendung.
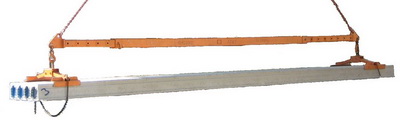
-
Holzbauweise
Überbegriff für die Bauweise, bei der hauptsächlich der Baustoff Holz eingesetzt wird, sei es für die Tragstruktur, als auch für nicht tragende Bauteile. Kanthölzer, Leimholz oder Brettsperrholz kommen hier zur Anwendung.

-
Holzverkleidung
Bauteilverkleidung mit Holzwerkstoffen, wie z.B. Bretter, Mehrschichtplatten, usw.; Mögliche Holzarten sind u.a. Fichte, Lärche, Föhre usw.
-
HPL-Platte
Bestehen aus mehreren Lagen Papier, in Kunstharzen getränkt, unter hohem Druck und hoher Temperatur und zwischen zwei Deckschichten gepresst; haben eine hohe Beständigkeit gegen Hitze, Licht, mechanische Einwirkungen und sind pflegeleicht.
-
Humus
Ist der sich zersetzende, tote, organische Anteil des Bodens (oberste Schicht des Bodens)

-
Hypothek
Grundpfandrecht, die Banken als Garantie für Kredite einsetzen. Die Hypothek ist in der Regel höher, als der Darlehensbetrag. Hypotheken werden im Grundbuch eingetragen. Lastet eine Hypothek auf einer Immobilie, sind die Rechte des Eigentümers eingeschränkt.
I
-
Industrieboden
Betonboden für hohe chemische und mechanische Beanspruchungen. Die oberste Schicht, auch Verschleißschicht genannt, kann aus einem Zement- Quarz- Gemisch hergestellt oder mit Reaktionsharzen behandelt werden. Industrieböden werden immer häufiger in Garagen vorgesehen.

-
Infrastrukturplan
Der Infrastrukturplan beschreibt die Gesamtheit aus Wegenetz, Abwasserleitungen und Versorgungsleistungen (Trinkwasser, Strom, Kommunikation, Gas, Fernwärme, usw.) und stellt dies graphisch dar.
-
Innenausbau
Ausbau im Inneren eines Gebäudes über der Rohbaukonstruktion (z.B. Putzlagen, Bodenaufbau, Fliesen, Böden, Installationen)
-
Innenmaße
Abmessungen zwischen zwei Bauteilen, die im Inneren eines Gebäudes gemessen werden (z.B. Rauminnenmaße, Öffnungen)
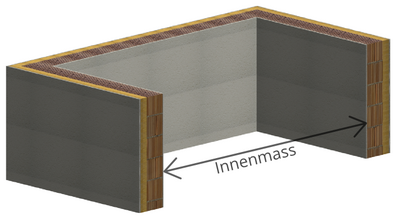
-
Installation
Fachgerechte Montage von technischen Anlagen, wie z.B. Wasser, Heizung, Strom, Gas, Lüftung, Kommunikation
-
Intensive Begrünung
Form der Dachbegrünung, welche nicht ohne Pflege auskommt. Als Gewächs gedeiht nahezu alles, z.B. Rasen, Sträucher, Bäume; hoher Pflegeaufwand; Zusatzbewässerung ist erforderlich; Intensive Begrünung ist als Nutzfläche geeignet

-
Isobeton
Umgangssprachlicher Begriff für Ausgleichsbeton mit Zuschlägen (z.B. Blähbeton oder Perlite) zur Verbesserung der Wärmedämmeigenschaften bezeichnet (siehe auch Ausgleichsbeton)
J
-
Jalousie
Sicht- und Sonnenschutz bei Verglasungen mit quer verlaufenden Lamellen, welche gedreht, hochgezogen oder geschlossen werden können

K
-
Kalk-Zement-Mörtel
Bindemittel aus Füll- und Verbindungsstoffen; Ist ein Gemisch aus gelöschtem Kalk und Sand und wird jenach Zusammensetzung in verschiedene Festigkeitsklassen unterteilt
-
Kalk-Zement-Putz
Atmungsaktiver, mineralischer Putz auf Kalk- Zementbasis für innen und außen
-
Kalkmörtel
Bindemittel aus Füll- und Verbindungsstoffen; Ist ein Gemisch aus gelöschtem Kalk und Sand und wird jenach Zusammensetzung in verschiedene Festigkeitsklassen unterteilt
-
Kalkputz
Atmungsaktiver, ökologischer, mineralischer Putz auf Kalkbasis für Innen- und Außenflächen
-
Kaltdach
Zweischaliges Dach mit vorhandener Hinterlüftung. Die Hinterlüftung dient dabei dem Abtransport der Feuchtigkeit, welche durch die Wärmedämmung vom Inneren des Gebäudes entweichen kann. Auf der Innenseite eines Kaltdaches wird daher in der Regel eine diffusionsoffene Folie angebracht (Dachbremse). Ein Kaltdach ist aufwändiger und teurer, als ein Warmdach, hat aber auch Vorteile, wie z.B. die bessere Abhaltung der Sommerhitze durch die vorhandene Luftzirkulation in der Hinterlüftungsebene.
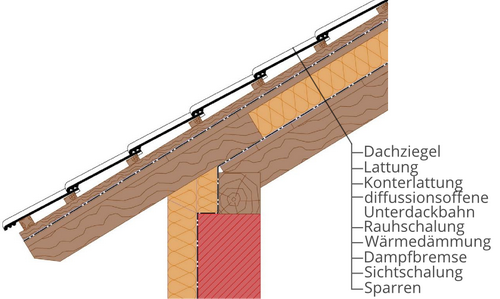
-
Kanalisation
Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur; bezeichnet das Ableitungssystem der gesamten Abwässer: RW… Regenwasserkanalisation, SW… Schmutzwasserkanalisation, MW… Mischwasserkanalisation (RW+SW)

-
Kantholz
Vierkantige, rechtwinklige und längsgeschnittene Hölzer. Die Querschnittsfläche, welche im rechten Winkel zur Längsachse steht, wird als Stirn- oder Hirnholz bezeichnet.

-
Kehlsparren
Bauteil der Dachkonstruktion ( Kantholz bzw. Leimholz), welches unterhalb einer Kehle eingebaut wird
-
Kernbohrung
Bei der Kernbohrung wird der zu bohrende Bauteil nur entlang des Bohrumfangs geschnitten, und der Bohrkern als Ganzes entfernt. Kernbohrungen werden meist bei Beton durchgeführt. Der Bohrumfang kann 1cm bis 150cm betragen.

-
Kippfenster
Verglasung, welche sich zum Öffnen nur kippen lässt

-
Klimahaus
Klimahaus bezeichnet einen Gebäude- Standard. Die Unterscheidung der Kategorien hängt vom Heizwärmebedarf eines Gebäudes ab. Die Klassen beginnen beim energiersparendsten “KlimaHaus Gold” über die Klassen A, B, C, D, E und F bis hin zum energetisch verschwenderischen “KlimaHaus G”.
-
Konsolengerüst
Gerüste, die direkt am Gebäude ohne Bodenkontakt befestigt werden bzw., welche an einem Fassadengerüst auskragend nach außen montiert werden, um auskragende Bauteile einzurüsten, z.B. an den Vordächern, um die Absturzgefahr während der Arbeitsausführung am Dach einzudämmen.

-
Konterlattung
Die Konterlattung verläuft von unten nach oben (von der Traufe zum First). Sie stellt die Hinterlüftungsebene dar, anschließend erfolgt die horizontale Lattung zur Verlegung der Dachplatten.

-
Kontorahmen
Möglichkeit der Unterschreitung des Kontos in einem bestimmten Rahmen Die Zinsen bis zum vertraglich festgelegten Betrag werden vereinbart. Sollte der Kontorahmen überschritten werden, gelten höhere Zinsen (siehe Bereich Bank)
-
Kontrollierte Lüftung
Gebäudeinstallation, die frische Außenluft kontrolliert in die Wohnräume einführt und die verbrauchte, warme Innenluft an die Umwelt abgibt. Hierbei wird mittels Wärmetauscher die Wärme der Innenluft teilweise an die kalte Außenluft übertragen, um somit die Wohnräume energiesparend, kontrolliert zu lüften.
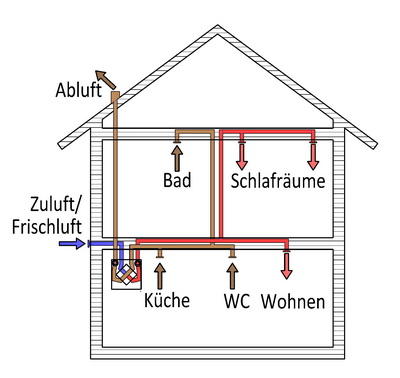
-
Korrosion
Chemischer Prozess eines Werkzeugs mit dessen Umgebung. Die im Bauwesen gängigste Form von Korrosion kennt man als “Rosten” von Metallen.
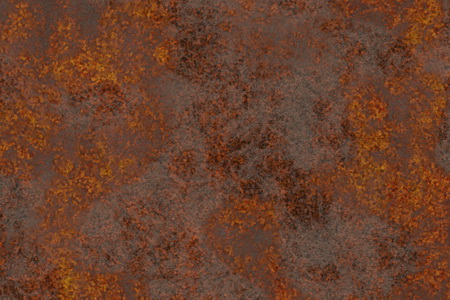
-
Korrosionsschutz
Bauliche und/ oder chemische Schutzmaßnahmen, um die Korrosion zu verhindern
-
Kostenberechnung
Berechnung der Kosten mittels genauer Angabe der Mengen und der festgelegten Einheitspreise
L
-
Lageplan
Zeichnerische Darstellung der Geländedraufsicht ( Vogelperspektive des Geländes)
-
Lambda-Wert
Bezeichnung der Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes ( Einheit W/mK). Die Wärmeleitfähigkeit ist der Wärmestrom, der bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin durch eine 1m² große und 1m dicke Schicht eines Stoffes fließt. Je kleiner der Wert, desto besser sind die Wärmedämmeigenschaften eines Werkstoffes.
-
Laminat
Werkstoff, bestehend aus mindestens zwei untereinander verklebten Schichten gleichen oder unterschiedlichen Materials. Im Bauwesen spricht man bei Bodenbelägen von Laminat.

-
Langlochziegel
Gelochter Mauerziegel mit horizontal verlaufendem Lochbild. Verglichen mit Hochlochziegeln, weist der Langlaufziegel eine geringere Festigkeit auf.

-
Laufmeter
Abkürzung lfm
-
Lebenslinie
An der Dachkonstruktion oder an absturzgefährdeten Stellen befestigtes Stahlseil, das als Schutzvorrichtung gegen Abstürze dient.

-
Leerrohr
Starres oder flexibles Rohr aus Kunststoff oder Metall, welches unter Putz oder auf dem Putz verlegt wird. Darin werden nachträglich Elektro- und Datenkabel eingezogen.
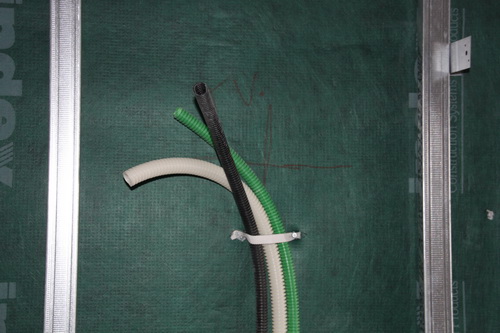
-
Leichtbeton
Beton, der durch Zugabe von Leichtbetonzuschlagstoffen eine niedrigere Dichte als normaler Beton bestitzt (500- 2000km/m³)
-
Lichtschacht
Ein Lichtschacht wird an unterirdischen Stockwerken eingebaut und endet an der Geländeoberkante. Dieser sorgt für Lichteinfall und Lüftung für die unterirdischen Geschosse. Ein Lichtschacht kann vor Ort mit Ortbeton errichtet werden oder als Fertigteilschacht an der Kellerwand befestigt werden.

-
Lieferbeton
Überbegriff für Beton, welcher ausgehend vom Betonwerk an die Baustelle geliefert wird
-
Linoleum
Bodenbelag, der zumeist aus Leinöl, Kork und Jute besteht, eine gute Wärme- und Trittschalldämmung aufweist sowie elastisch und einfach zu verlegen ist

M
-
Magerbeton
Meist unbewehrter Beton mit geringer Festigkeit; wird als Sauberkeitsschicht unter den Fundamenten eingebracht oder als (Füll-)Beton für statisch irrelevante Bauteile verwendet
-
Massivbauweise
Oberbegriff für die Bauweise, bei welcher hauptsächlich die Baustoffe Beton und Ziegelmauerwerk Anwendung finden und dabei Wände und Decken die statische Funktion übernehmen. Das Gegenteil ist die Skelettbauweise, bei der Stützen und Träger aus Stahlbeton die tragende Wirkung übernehmen und die weiteren Bauteile nicht tragend ausgeführt werden.

-
Mauerabdeckung
Oberer Abschluss einer vertikalen Mauer, der als Witterungsschutz dient. Die Mauerabdeckung kann mit Natur- oder Kunststeinen gebaut werden, aber auch mit Stahlblech oder witterungsbeständigen Hölzern. Unter dem Mauerüberstand besitzt die Mauerabdeckung eine Tropfnase.
-
Mauerschlitz
-
Mauerwerk
Mauer- oder Wandkonstruktion, bestehend aus Natur-, Ziegel- oder Betonsteinen

-
MDF-Platten
Mitteldichte Holzfaserplatten, die aus feinen Fasern aus rindenfreiem Nadelholz hergestellt werden; kommen im Innen- und Dachausbau zum Einsatz
-
Meterriss
Markierung im Rohbaustadium als Referenz für alle nachträglich ausgeführten Arbeiten. Der Meterriss liegt einen Meter über dem fertigen Boden und dient der Herstellung von Unterböden, Estrichen, Bodenbelägen, Brüstungshöhen, Sturzhöhen und für die Positionierung von Installationen und Sanitäreinrichtungen.

-
Mikropfähle
Stahlpfähle, welche im Boden zeitgleich gedreht und gedrückt werden. Sie leiten die von außen aufgebrachten, vertikalen Kräfte über die Mantelreibung zwischen Pfahl und Erdreich in den Boden. Verwendung finden Mikropfähle als Gründung von Gebäuden, bei Böden mit unzureichender Festigkeit bzw. bei Baugrubensicherungen in Verbindung mit Zugankern.
-
Milchglas
Umgangssprachlich für Opalglas oder Weißglas, das lichtdurchlässig, aber undurchsichtig ist.

-
Mindestgefälle
Angabe in % oder ‰ für die minimal erforderliche Neigung einer Oberfläche. In der Regel spricht man von Mindestgefälle, wenn es um die Entwässerung von Oberflächen geht. Das Mindestgefälle hängt vom Abdichtungsmaterial ab oder vom vorgesehene Material der Dackdeckung (z.B. Blechdach, Dachplatten, Ziegelsteine)
-
Mischwasser
Bezeichnung für die Mischung von Schmutz- und Regenwasser, wenn die Abwasserleitungen nicht getrennt voneinander verlegt sind
-
Mörtel
Auch “malta” genannt; Gemisch aus Bindemittel, Gesteinskörnung, Wasser und ggf. weiteren Zusatzstoffen, abhängig vom Anwendungsbereich. Als Bindemittel kommen Kalk oder Zement zur Anwendung.
Kalkmörtel: Sand, gelöschter Kalk und Wasser
Zementmörtel: Sand, Zement und Wasser
Kalkzementmörtel: Sand, Kalk, Zement und Wasser (gängigster Mörtel)
-
Mutterboden – Erde
Natürlich gewachsene, humusreiche Oberschicht des Erdreichs

N
-
Nachhaltigkeit
Prinzip, in der bei einem natürlichen Bereich die Nutzung der Ressourcen so gehandhabt wird, um einen langfristigen Erhalt des Bereichs zu gewährleisten. Verwandte Begriffe sind Langlebigkeit, Dauer, Erhalt, Ausbeute geringer oder gleichwertig des Nachkommens, usw..
-
Nassraum
Ein Nassraum wird als solcher bezeichnet, sobald die Notwendigkeit eines Bodenablaufs besteht. Dies kann ein Feuchtraum mit sehr hoher Feuchtigkeit sein, wobei die Feuchtigkeit durch Kondensation an den Wänden abläuft oder ein Raum, welcher aus unterschiedlichen Gründen mit Wasser abgespritzt wird (Garagen, Schlachthöfe, usw.).
-
Nasszelle
Im Allgemeinen ein kleiner Raum (Zelle) mit wasserfestem Boden, wie z.B. WC, Badezimmer, Waschraum, usw.

-
Natürliche Lüftung
Im Gegensatz zur kontrollierten Lüftung erfolgt die natürliche Belüftung über das Öffnen von Fenstern und Türen


-
Natursteinmauer
Mauerwerk, hergestellt aus Natursteinen statt künstlicher Ziegelsteine. Natursteinmauern sind teurer als Ziegelmauern oder Betonwände, jedoch langlebiger und von hoher Ästhetik.
Zyklopensteinmauer: Natursteinmauer, hergestellt aus großen Steinen
Trockenmauer: Natursteinmauer, errichtet ohne Verwendung von Mörtel
-
Nettowohnfläche
Summe aller belegbaren Bodenflächen innerhalb einer Wohnung inkl. wohnungsinterner Treppen. Nicht hinzugezählt werden Wandquerschnitte, Nebenflächen, wie Balkone, Terrassen, Garagen und nicht bewohnbare Räume.
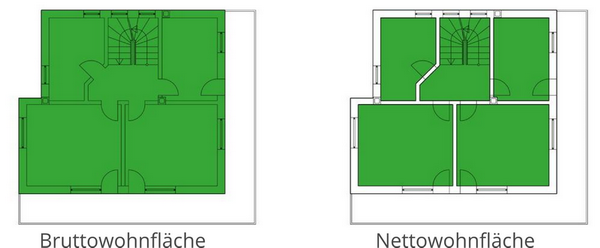
-
Nettowohnfläche, Nettowohnflächen,
Bauteile einer Gebäudekonstruktion, welche keine statische Aufgabe übernehmen, d.h., die keine Lasten, abgesehen vom Eigengewicht, tragen müssen. Das gängigste Bauteil, bei welchem die Frage nach “tragend” oder “nicht tragend” aufkommt, ist die Innenwand.
-
Notbeleuchtung
Beleuchtungskörper, die sich bei Stromausfall automatisch einschalten, um z.B. Fluchtwege zu markieren. Die Notbeleuchtung ist mit Akkumulatoren versehen.
-
Nutzlast
Anteil der statischen Lastannahmen, der die zulässigen Lasten im endgültigen Zustand eines Gebäudes für die Nutzung desselben festlegt. Zu den Nutzlasten zählt man Personen, Einrichtungsgegenstände, Lagerstoffe, Maschinen, Fahrzeuge, usw.
Einige Beispiele für Nutzlasten:
Wohnräume 200kg/m²
Balkone 400kg/m²
Parkgaragen bis 3,5t- Fahrzeuge 250kg/m²
Veranstaltungssäle, Einkaufszentren 500kg/m²
Magazine, Lagerräume, Bibliotheken > 600kg/m² (von Fall zu Fall unterschiedlich)
Die Eigenlast hingegen besteht aus den Lasten der tragenden Konstruktion (z.B. Rohbau) und der Ausbauschichten (z.B. Bodenaufbau, Verputz, Installationen). O
-
oberirdische Kubatur
Definiert sich durch die Volumenabmessungen oberhalb des (geplanten) Geländes
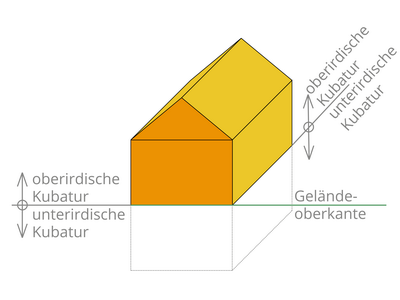
�
-
Ökologisch
Naturbewusst, umweltverträglich

O
-
Ortbeton
Beton, der im Gegensatz zum Fertigteil auf der Baustelle in die Schalungen eingebracht und erhärtet wird

-
Ortgang
Oder Stirn (Stirngang); bezeichnet den seitlichen Abschluss des Dache

-
OSB-Platten
Auch Grobspanplatten genannt; werden aus langen, schlanken Spänen unterschiedlicher Dicke und unter hohem Druck mit Leimverklebung hergestellt.

-
Oxidation
Chemische Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff
P
-
p.i.
perito industriale, Fachingenieur, Techniker mit Abschluss einer Gewerbeoberschule und entsprechender Staatsprüfung
-
Paneel
Großflächige Tafel oder Platte aus Holz, Kunststoff, furnierten oder beschichteten Spanplatten oder mehrschichtigen Bauteilen für Wand- oder Deckenverkleidungen
-
Parkett
Bodenbelag aus Holz, meist hartes Laubholz, welches in unterschiedlichen Größen und Mustern eingebaut wird bzw. als fertige Parkettriemen verlegt wird. Parkettböden haben eine Massivholz- Naturschicht, welche sich einige Male abschleifen lässt, um alten, zerkratzten Böden einen neuen Glanz zu verleihen.

-
Passivhaus
Gebäude, das aufgrund seiner hervorragenden Wärmedämmeigenschaften nur mit der Sonneneinstrahlung beheizt wird und keine weitere Beheizung erforderlich macht
-
PE – Polyethylen
Thermoplastischer Kunststoff auf Ethylengas- oder Ethanol- Basis. Im Bauwesen findet Polyethylen hauptsächlich bei den Rohren, wie Trinkwasser- und Kabelschutzrohren, Anwendung.

-
Perimeterdämmung
Wärmedämmung an der Außenseite von Bauteilen eines Gebäudes, welche in Kontakt zum Erdreich stehen (Kellerwände, Fundamentplatte). Die Dämmung muss wasser- und druckbeständig sein. In der Regel werden XPS- Platten verwendet.
-
Perlit
Rohstoff aus Gestein; durch Glühen wird das Volumen stark vergrößert. Nach der Aufblähung besitzt er eine geringere Dichte und eine gute Wärmedämmeigenschaft. Deshalb werden Perlite als Zuschlagstoff für Leichtbeton, Wärmedämmputz, Ausgleichschichten mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften sowie als Zwischendämmung verwendet.

-
Phasenverschiebung
Dauer, welche die außen auftretende Hitze braucht, um durch den gesamten Dachaufbau ins Innere des Gebäudes durchzudringen. Dieser Begriff ist beim “sommerlichen Hitzeschutz” ein nicht zu vernachlässigendes Argument. Die optimale Dauer der Phasenverschiebung beträgt 10 bis 14 Stunden, was zur Folge haben würde, dass z.B. die Mittagshitze, erst nachts an die Räume abgegeben würde. Nachts ist die Außentemperatur aber weitgehend abgekühlt, so dass die Wärme nach außen abgegeben wird.
-
Planziegel
Ziegelsteine mit plangeschliffenen Auflageflächen; in Dünnbettmörtel verlegt
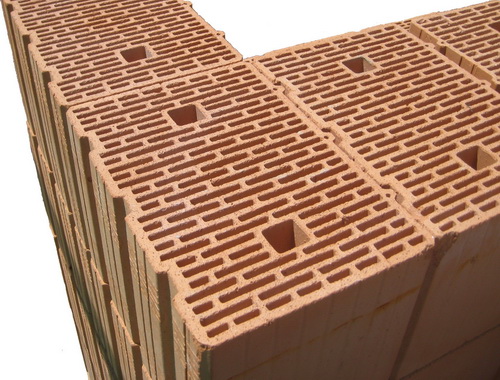
-
Plattendecke
Armierte Betonfertigteile für die Herstellung von vollen Massivbetondecken oder solche mit gewichtsreduzierenden Styropor- bzw. Ziegeleinlegern. Die im Werk vorgefertigte, schalenartige, 4 bis 6cm dicke Stahlbetonplatte dient dabei als Grundgerüst der Decke. An der Baustelle wird anschließend der Aufbeton als Ortbeton eingebaut. Die unterseitige, tragende Bewehrung wird bereits im Werk in die Elementdecke eingebaut.

-
Plattenfundament
Gehört zu der Kategorie Flachgründung. Im Gegensatz zum Streifen- oder Einzelfundament, wird das Plattenfundament als zusammenhängende Platte gegossen. Es bietet den Vorteil der gleichmäßigeren Lastverteilung bei schlechtem Baugrund, des einfacheren Aushubs und der besseren Feuchtigkeitsabdichtung.

-
Potentialausgleich
Meint die leitfähige Verbindung aller elektrischen Geräte und Betriebsmittel mit dem geerdeten Schutzleiter, um die einzelnen, elektrischen Potentiale untereinander auszugleichen und zu minimieren. Dies wiederum bewirkt die Reduzierung des Risikos eines elektrischen Schlags.
-
Projektunterlagen
Nutzen Sie den Bereich “Projektunterlagen” für den praktischen Dokumentenaustausch zwischen Bauherr, Techniker und Handwerker.
Achtung: Es MUSS mindestens ein Dokument hochgeladen werden. z.B. das Einreichprojekt oder im Falle einer Badsanierung ein Foto vom bestehenden Bad.
-
PUR – Polyurethan
Kunststoffe oder Kunstharze, die aus der Polyadditionsreaktion (Mehrfachreaktion) entstehen. Verwendung finden diese als Montageschaum, als Isolier- oder Dämmschicht. Als Dämmschicht wird Polyurethan hauptsächlich dann verwendet, wenn die Anforderungen an die Dämmwirkung hoch sind, jedoch die Dämmschicht aus Platzgründen klein gehalten werden muss. Die Wärmeleitfähigkeit von Polyurethan liegt bei 0,025W/mK, im Vergleich zu anderen Dämmstoffen, welche im Bauwesen Verwendungen finden mit λ = 0,03- 0,045W/mK


-
Putzbewehrung
Einlagen (Netze) aus Metall, Textil- oder Kunststofffasern, die zwischen den Putzlagen eingebaut werden, um die Rissbildung aufgrund temperaturbedingter Oberflächenspannungen zu reduzieren.

-
PVC – Polyvinylchlorid
Harter und spröder Kunststoff, der jedoch durch Weichmacher formbarer und weicher wird. Die bekanntesten Verwendungszwecke sind Abdichtungsbahnen, Fußböden, Fensterprofile, Abwasserrohre und Kabelisolierungen.

Q
-
Quellbeton
Beton, der sich durch Zugabe von Quellzement während dem Abbinden und Erhärten ausdehnt. Quellbeton wird bei Unterfangungen und bei Bauteilen mit erwünschter Vorspannwirkung angewendet.
R
-
Raffstore
Sonnen- und Witterungsschutz bei Verglasungen an der Außenfassade mit quer verlaufenden Lamellen, welche gedreht, hochgezogen oder geschlossen werden können

-
Rahmenbauweise
Auch Skelett- oder Gerippebauweise genannt; meint die Konstruktion eines Bauvorhabens mittels vorgefertigten, tragenden Elementen. Dadurch entsteht das Gerippe des Bauvorhabens, welches im zweiten Schritt um die nichttragenden Elemente ergänzt wird. Rahmenbauweise kann in Stahl, Stahlbeton sowie in Holz ausgeführt werden. Im Wohnungsbau im Raum Südtirol findet eher die Holz- Rahmenbauweise Anwendung. Größere Betriebs- und Lagerhallen werden des öfteren in Stahl- Rahmenbauweise ausgeführt.
-
Randdämmstreifen
Dient als Schalltrennung zwischen dem Bodenaufbau und den aufgehenden Wänden und wird vor dem Einbringen des Estrichs entlang der raumbegrenzenden Mauern verlegt

-
Rauschalung
Bretterschalung mit sägerauer Oberfläche. Wird in der Regel dort vorgesehen, wo sie nach der Fertigstellung nicht mehr sichtbar ist, z.B. zwischen der Hinterlüftung der Dächer und der Dachdeckung.

-
Regenfallrohr
An der Fassade befestigtes, senkrechtes Rohr zur Entwässerung von Dachflächen, Terrassen usw.

-
Rohbau
Bauwerk, bei dem die tragende Struktur und die Dachkonstruktion festgestellt sind. Der Innenausbau, die Fassadenverkleidung, Fenster und Türen gehören nicht mehr zum Rohbau. Die Trennwände gehören aus unserer Sicht zu dem Rohbau.

S
-
Sandstrahlen
Verfahren zur Oberflächenbehandlung, welches ein Luft- Sand- Gemisch mit hohem Druck gegen die zu behandelnde Oberfläche strahlt. Der Sand dient dabei als Schleifmittel. Sandstrahlverfahren werden zur Beseitigung von Rost, Verschmutzungen, Beschichtungen und als ästhetische Oberflächenbehandlung angewendet. Alternativ zum Sandstrahlen gibt es mittlerweile auch Kunststoff-, Glasperlen- und Trockeneis- Strahlverfahren.

-
Sanier-Putzmörtel
Putzmörtel für feuchte, salzhaltige Mauerwerke; besitzt einen hohen Anteil an Luftporen, welche bereits in der Putzschicht die Verdunstung ermöglicht.
-
Sauberkeitsschicht
Dünne Betonschicht aus nicht bewehrtem Magerbeton, die vor dem Verlegen der Fundamentbewehrung gegossen wird, um eine erdfreie, “saubere” Arbeitsschicht zu gewährleisten.
-
Schalbretter
Holzbretter, die für das Einschalen von Betonbauteilen verwendet werden; kommen bei sehr kleinen Stahlbetonbauteilen sowie bei Bauteilen mit Sichtbetonoberfläche zur Anwendung

-
Schallbrücke
Übertragung von Schall durch zwei untereinander verbundene Bauteile
-
Schalldämmung
Isolierendes Bauteil oder Schicht, die die Schallübertragung verhindert bzw. reduziert, z.B. Trittschalldämmung unter den Fußbodenbelägen oder Wärmedämmung an Fassaden, welche ebenfalls eine schalldämmende Wirkung mit sich bringt (z.B. Steinwoll- Dämmplatten)
-
Schaltafeln
Tafeln aus Metall oder Holz, welche für die Einschalung von Ort-, bzw. Lieferbeton verwendet werden. Übliche Schaltafeln werden industriell aus mehrschichtigem Holz gefertigt (z.B. 2,0-2,5-3,0m lang x 0,5m breit) Großflächenschalungen werden in Metall gefertigt (siehe Großflächenschalung)

-
Schalung
Allgemeiner Begriff für die Werkzeuge/ Materialien, die für die Gussform des Ort-, bzw. Lieferbetons verwendet werden
-
Schattenfuge
Gestalterische Fuge zwischen zwei Bauteilen, um diese optisch getrennt wirken zu lassen, z.B. zwischen Wand und Decke bzw. als Spalt zwischen den einzelnen Brettern einer Fassadenverkleidung
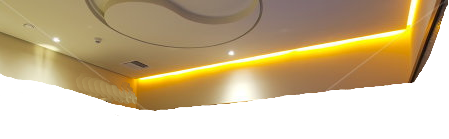

-
Schaumbeton
Beton, welcher unter Verwendung von Schaum- bzw. Luftporenbildnern hergestellt wird. Verwendung findet dieser Beton als Ausgleichsschicht auf Installationsrohren. Schaumbeton hat eine geringe Dichte und Druckfestigkeit.

-
Schaumglas
Wärmedämmstoff aus aufgeschäumtem Glas. Seine Vorteile sind die hohe Druckfestigkeit, keine Wasseraufnahme und das Abhalten von Dampf. Schaumglas findet als Perimeterdämmung unter Fundamenten und als Mauerfußdämmung Verwendung.
-
Schindeln
Kleine bis mittelgroße Elemente, welche als Dachdeckung und Fassadenverkleidung Anwendung findet. Meist wird die Schindel aus Holz als Dachabdeckung verwendet (Holzschindel). Schindeln gibt es jedoch in verschiedenen Materialien, z.B. Aluminium, Ton, Schiefer, Kupfer oder Bitumen. Ebenfalls unterscheiden sich die Schindeln in ihrer Form.
-
Schornstein
Senkrechte Konstruktion zur Abführung von Abluft und Abgasen, im Bauwesen als Kamin bezeichnet

-
Schornsteinkopf
-
Schutzbeton
Betonschicht zum Schutz der darunterliegenden Schichten, z.B., um Beschädigungen von Abdichtungsbahnen zu vermeiden. Die Mindeststärke liegt bei ca. 4- 5 cm. In der Regel wird eine dünne Baustahlmatte als Schutz vor Rissbildung eingelegt.
-
Schwimmender Estrich
Estrich, der von den unteren und seitlichen Bauteilen mittels Trennlagen getrennt ist, um die Ausdehnung aufgrund von Schwinden und Dehnen des Estrichs schadensfrei zu gewährleisten und um die Schallübertragung zu reduzieren. Dabei wird horizontal eine Trennlage (Nylonfolie bzw. Trittschalldämmung) zwischen Untergrund und Estrich eingezogen und vertikal zwischen den seitlich aufgehenden Wänden und dem Estrich wird ein Randdämmstreifen vorgesehen.
-
Sicherheitsglas
Unterschieden wird zwischen Einscheiben- Sicherheitsglas (ESG) und Verbund- Sicherheitsglas (VSG). Sicherheitsglas weist eine höhere Stoß- und Schlagfestigkeit auf. ESG zerfällt in kleine Scherben, was die Verletzungsgefahr stark reduziert. VSG ist ein Glasverbund aus mindestens zwei Schichten Glas, bei dem zwischen den Glasschichten eine reißfeste und zähelastische Folie eingebracht wird. Bei Bruch verhindert die Folie die Zersplitterung und reduziert die Verletzungsgefahr, außerdem wirkt die Folie einbruchhemmend. In Abhängigkeit von Glasstärke und Folientyp sowie Anzahl der Schichten entsteht Panzerglas.
-
Sichtbeton
Bauteil aus Stahlbeton mit einer Oberfläche, die nach dem Betonieren nicht weiter behandelt wird (kein Verputz, keine Verkleidung). Die Oberfläche erhält dabei eine vorab gewählte Struktur, welche mittels Oberflächeneinlagen direkt auf der Schalung erzielt wird. Eine gängige Form von Sichtbeton ist die Einlage von schmalen Schalbrettern, die dem Beton die besondere Struktur verleihen. Am Markt gibt es unzählige Struktureinlagen, welche unterschiedlichste Oberflächenstrukturen zur Auswahl anbieten, wie z.B. Wellen-, Noppen-, Sägezahnmuster, usw.
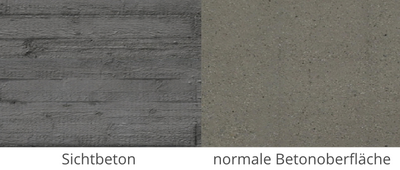
-
Sichtmauerwerk
Mauerwerkskonstruktion, welche im endgültigen Zustand sichtbar bleibt. (z.B. Verblendmauerwerk mit Vollziegeln, Klinkern oder Natursteinen). Natursteinmauern sind eigentlich immer Sichtmauerwerke.

-
Sichtschalung
Holzbretter, die in Sicht montiert werden. In der Regel versteht man darunter eine gehobelte Holzschalung, z.B. die sichtbare Unterseite von Dachkonstruktionen

-
Silikatputz
Oberputz auf Silikatbasis (Salzbasis), witterungsbeständig und wasserdampfdurchlässig (diffusionsoffen), wird hauptsächlich an Außenfassaden angewendet. Kann auch ohne weiteren Anstrich aufgetragen werden.
-
Sparren
Teil der Dachkonstruktion, der auf den horizontalen Pfetten aufliegt. Die Sparren verlaufen von der Firstpfette bis hin zur Fußpfette hinaus als Vordach, sofern vorgesehen.
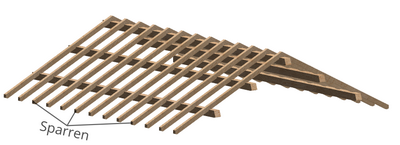
-
Spritzbeton
Beton, der durch eine Spritzdüse auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen und durch die Aufprallenergie verdichtet wird. Die wichtigsten Anwendungen sind Hang- und Baugrubensicherungen, Tunnelbau, usw.

-
Spritzbewurf
Haftgrund für Unterputz, der vollflächig auf wenig saugende oder glatte Oberflächen aufgetragen wird. Der Spritzbewurf kann mittels Kelle, Quast oder mit der Verputzspritzmaschine aufgetragen werden.

-
Stoßlüften
Kurzes, intensives Lüften von Räumen, wobei die Fenster vollständig geöffnet werden. Dient dem Luftaustausch und der Verminderung der Luftfeuchtigkeit.

-
Streifenfundament
Fundamenttyp der Kategorie Flachgründung, bei dem nur unter den tragenden Mauern ein bewehrter Stahlbetonstreifen gegossen wird, um die vertikalen Kräfte aus den Wänden in den Boden zu leiten.

-
Sturz
Obere Abdeckung einer Maueröffnung mit einem horizontalen Träger oder Überleger. Je nach Öffnung wird zwischen Tür- und Fenstersturz unterschieden.

-
Systemdach
Bauweise der Dachkonstruktion, bei welcher die Vordachsparren auf die Innendachsparren verlegt werden, die Vordächer werden dabei nicht gedämmt.Die Dachaufbauten gut gedämmter Dächer erreichen mittlerweile 30cm und mehr. Um die Vordächer nicht so stark und wuchtig wirken zu lassen, bietet sich mit dem Systemdach eine gute Lösung. Hauptvorteil des Systemdachs ist die schlanke Bauweise der Vordächer.
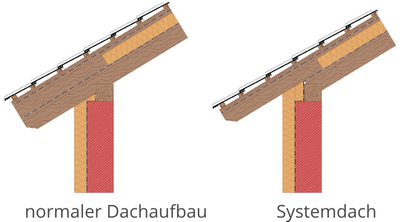
T
-
Teer
Organisches, braun bis schwarzes, zähflüssiges Material, welches durch zersetzende, thermische Behandlung von organischen Naturstoffen gewonnen wird. Wurde früher im Straßenbau verwendet, heute jedoch nicht mehr. Allerdings ist der Begriff “teeren” erhalten geblieben. Heutzutage werden Bitumenprodukte verwendet.
-
Teilzahlung
Bezahlung eines Anteils vom Gesamtbetrag. Die Höhe und der Zeitpunkt der Anzahlung kann mittels Werkvertrag festgelegt werden.
-
Thermostat
Auch Temperaturregler genannt, der über einen Temperaturfühler die vorhandene Temperatur mit der vorgegebenen bzw. eingestellten Temperatur vergleicht und in Abhängigkeit der Differenz ein Regelelement öffnet oder schließt. Thermostate gibt es in mechanischer oder elektronischer Form.

-
Trennwand
Tragende oder nicht tragende Wand zwischen zwei aneinanderliegenden Räumen, Wohneinheiten oder Gebäudeteilen. Umgangssprachlich wird oft die nicht tragende Wand als Trennwand bezeichnet.
-
Treppenauge
Auch Treppenloch genannt; bezeichnet die Öffnung einer Treppe, der von den Stufen und Absätzen gebildet und umschlossen wird.

-
Trittschalldämmung
Dient der Schalldämmung von Trittschall (gehen, tanzen, hüpfen, Möbel rücken, usw.). Trittschalldämmung gibt es in Form von Matten unterschiedlichster Materialien, welcher unter den Bodenbelägen verlegt werden. Auch eine massive Decke sorgt bereits für eine gute Trittschalldämmung.
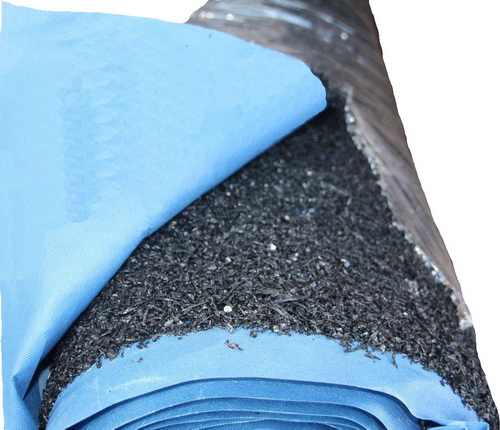
-
Trockenbauweise
Bauweise mit industriell gefertigten Bauteilen für die Herstellung von nicht tragenden Bauwerksbauteilen. Hauptsächlich finden Holz- und Gipsbauteile Anwendung, welche auf der Baustelle verschraubt oder genagelt werden. Im Trockenbau kommen keine wasserhaltigen Baustoffe zur Anwendung, was den Vorteil der geringeren bzw. nicht auftretenden Baufeuchte mit sich bringt.

-
Trockeneisstrahlen
Druckluftstrahlverfahren, bei dem Trockeneis als Oberflächen- Reinigungsbehandlung eingesetzt wird. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass das Trockeneis im Umgebungsdruck vom festen, direkt in den gasförmigen Zustand übergeht und somit keine Rückstände hinterlässt.

-
Trockenputz
Vorsatzschalung aus Gipskarton-, Gipsfaser- oder Zementfaserplatten, welche direkt auf die Rohbau- Innenwand geklebt oder mittels Unterkonstruktion montiert wird. In der Massivbauweise entspricht der Trockenputz dem Verputz.
-
Tropfblech
Abschlussblech des Daches, welches in die Dachrinne mündet bzw. Abschluss eines Bauteiles, um das anfallende Wasser von darunterliegenden Wandflächen mit bestimmtem Abstand abtropfen zu lassen und somit vor Nässe zu schützen.

-
Tropfnase
Auch Wassernase genannt; meint die Strukturen oder Rillen an der Unterseite herausragender Bauteile (Balkone, Mauerabdeckungen, Fensterbänke, usw.), um den Ablauf des Niederschlags zu verbessern und die Flächenunterseite oder eine senkrecht dazu verlaufende Wand vor Nässe zu schützen.

�
-
Überleger
Horizontaler Träger über einer Tür- oder Fensteröffnung in einer Ziegelwand

-
Überzug-Träger
Träger, der an der Deckenunterseite bündig zur Decke liegt und an der Deckenoberseite hinausragt. In der Regel spricht man von Überzügen bei Stahlbetonbauteilen, jedoch kann auch bei Holz und Stahl dieser Begriff Anwendung finden.
U
-
Umbautes Volumen
Komplettes Bauwerksvolumen, welches von der Gebäudehülle umschlossn wird (ausgehend von den Fundamenten bis zur Dachaußenfläche, innerhalb der Fassadenaußenfläche)
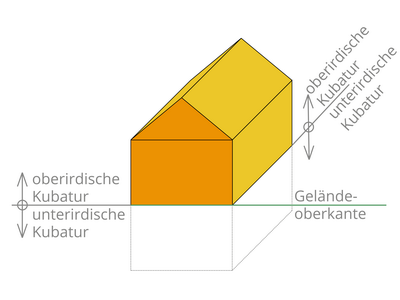
-
Umkehrdach
Andere Bauart des Warmdaches (nicht belüftetes Dach), welches als Flachdach ausgeführt wird. Dabei wird die Dämmschicht über der Abdichtungsebene (regendichte Haut) im Nassen verlegt. Die Dämmschicht muss daher wasser- und feuchtebeständig sein (z.B. XPS- Platten)
-
Unterfangung
Notwendige Baumaßnahmen, um ein bestehendes Gebäude, eine Stützmauer oder andere Konstruktionen um einen tieferen, angrenzenden Bereich zu ergänzen
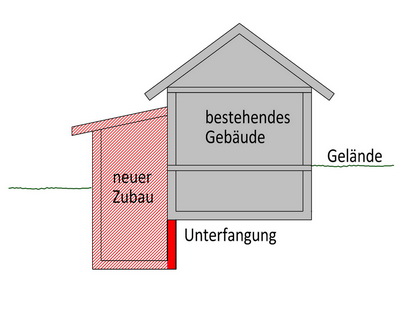
-
unterirdische Kubatur
Definiert sich durch die Volumenabmessungen unterhalb des (geplanten) Geländes
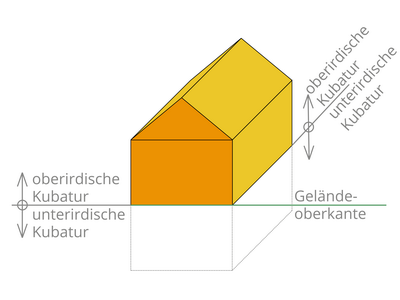
-
Unterputz-Installation
Art der Verlegung von Installationen, dabei werden die Bauteile der jeweiligen Installationen (Rohre, Leitungen, Dosen, usw.) unter der Putzschicht verlegt, d.h. nach der Fertigstellung sind die Installationen nicht mehr sichtbar. (Gegenteil ist die Aufputz- Installation)
-
Unterzug
Träger, der an der Deckenunterseite herausragt. In der Regel spricht man bei Stahlbetonbauteilen von Unterzügen, jedoch kann dieser Begriff auch bei Holz und Stahl Anwendung finden
-
urbanistische Kubatur
Die genauen Bestimmungen für die urabnistische Kubatur werden von den jeweiligen Gemeinden festgelegt. In dieser Kubaturberechnung werden meist nur die bewohnbaren Bereiche des Gebäudes berücksichtigt, d.h. die Kellerräume, nicht bewohnbare Dachgeschosse, Dachgeschosse H< 1,50m werden in den meisten Fällen nicht berücksichtigt. Wohlgemerkt, die Volumen der Außen- und Innenwände gelten als Teil der Kubatur.
V
-
Verblendmauerwerk
Nicht tragendes Mauerwerk aus Natur- oder Kunststeinen, welches vor der tragenden Mauer aus architektonischen Gründen errichtet wird. Ist z.B. eine Fassade aus Natursteinen erwünscht, so ist zwecks Einbringung der Dämmschicht eine zweischalige Außenwand erforderlich, wobei die Innenschale tragend ausgeführt wird.
-
Verblendung
Verkleidung eines Bauteils mit einem anderen Baustoff, meist aus ästhetischen Gründen
-
Verbundglas
Überbegriff für Glas, welches aus mindestens zwei Schichten besteht und miteinander verklebt ist, je nach Art, Dicke und Verwendung spricht man von Sicherheits-, Schallschutz-, bzw. Brandschutzglas.
-
Verlorene Schalung
Jene Schalung, welche nach dem Betonieren nicht wieder ausgebaut wird bzw. werden kann. Meist werden Holzbretter oder Schaltafeln verwendet, z.B. bei schwer zugänglichen Fundamenten, Mauern oder Deckenbereichen.
-
Vermessung
Aufnahme beliebiger Gelände- und Gebäudepunkte sowie die anschließende Verarbeitung der Daten mittels Vermessungsgeräten, um ein Geländemodell bzw. Lageplan zu erstellen. In der Regel ist bei fast jedem Neubau mit geneigtem oder unregelmäßigem Gelände eine Vermessung notwendig.

-
Verschnitt
Menge des überschüssigen Materials nach dem Zuschnitt
-
Versiegelung
Beschichtung von Baustoffen, um die Oberfläche gegen Ein- oder Ausdringen von anderen Substanzen abzudichten

-
Vlies
Natürlich oder künstlich hergestellter Faserstoff, der meist als Trenn- oder Schutzlage eingebaut wird

-
Vorlauftemperatur
Begriff in der Heiztechnik; meint die Temperatur des wärmeübertragenden Meidums (meist Wasser), welches in einen Heizkreis eingeleitet wird.
Fußbodenheizung 30°- 40°
Heizkörper >60°
Das wärmeüber tragende Medium, das vom Heizkreis zurückkehrt, bezeichnet man als Rücklauf. -
Vorsatzschale
Teil eines zweischaligen Wandaufbaus, wobei die Vorsatzschale ein nicht tragender Bauteil ist. Die Vorsatzschale kann ästhetische Gründe besitzen (Verblendung), bzw. akustische Gründe (dünnes Ziegelmauerwerk mittels Hohlraum vom tragenden Bauteil getrennt)
W
-
Wandaufbau
Beschreibt die einzelnen Schichten einer Wandkonstruktion, entweder in Textform oder als graphische Darstellung.
- Innenanstrich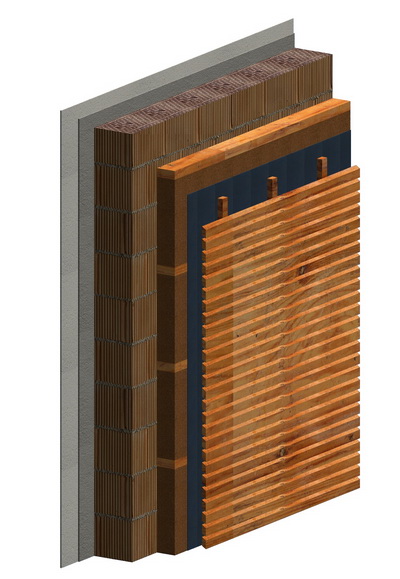
- Innenputz
- Ziegelmauerwerk 30cm
- Steinwolldämmplatte 16cm
- Kleber, Armierungsgewebe
- Hinterlüftung, Lattung 40mm
- Verkleidung mit Lärchenholz 25mm -
Wandheizung
Flächenheizsystem, bei dem die Heizelemente direkt in die Wand eingebaut werden (in der Putzlage). Diese Heizform gibt viel Wärme in Form von Strahlungswärme ab und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima.

-
Warmdach
Einschalige Dachkonstruktion ohne Hinterlüftung, daher auch unbelüftetes Dach. Die Dämmung liegt dabei unter der regendichten Haut und unter der Dämmung befindet sich eine Dampfsperre (wasserdampfundurchlässige Haut), welche die Raumfeuchtigkeit von der Dämmschicht abhält.
-
Wärmebrücke
Umgangssprachlich auch Kältebrücke genannt; können konstruktiver oder geometrischer Art sein bzw. abhängig von den Baustoffen. Die Wärmebrücke beschreibt die Bereiche, die schneller die Wärme nach außen abgeben, als die restliche Gebäudehülle. Problembereiche sind z.B. auskragende Bauteile wie Balkone, Attikamauern, usw.

-
Wärmedämm-Verbundsystem
Abk. WDVS oder WDV- System; beschreibt den gesamten Wärmedämmaufbau auf Gebäudeaußenwandflächen, bestehend aus Dämmschicht, Armierungsgewebe, Befestigungshilfsmitteln, Klebstoffen und Bindemitteln. Am Markt gibt es unzählige Aufbauvarianten und anwendbare Materialien.

-
Wärmedämmmörtel
Mörtel, der unter Zugabe bestimmter Stoffe, eine bessere Wärmedämmeigenschaft aufweist. Wird bei Mauerwerken mit Dünnbett- Verlegung angewendet.
-
Wärmedämmputz
Putzmörtel, der mittels Zusatz von Polystyrol, Vermiculite oder Perlite eine geringe Wärmeleitzahl besitzt. Wärmedämmputz wird angewendet, sobald der Wandaufbau allein nicht die erforderlichen Wärmedämmeigenschaften erreicht. Der Wärmedämmputz wird als Unterputz (Grobputz) aufgetragen, gefolgt vom Oberputz.
-
Wärmedämmung
Reduzierung des Wärmeflusses durch eine Schicht, um entweder eine Erwärmung oder eine Abkühlung zu verhindern. Im Bauwesen erfolgt dies durch die Wärmedämmmaterialien, welche hauptsächlich die Auskühlung der Gebäude in den kälteren Monaten verhindert und auch im Sommer teilweise vor Hitze schützt.
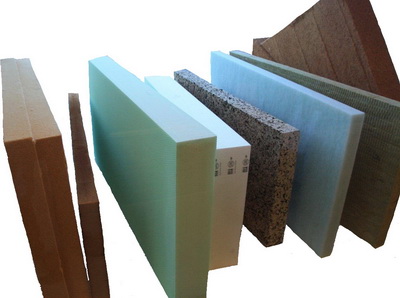
-
Wärmedurchgangskoeffizient
Wärmedurchgangskoeffizient, U- Wert, k- Wert (früher); Bauteilspezifischer Wert in Abhängigkeit der vorhandenen Bauteilschichten, deren Wärmeleitfähigkeit, Schichtdicke und Wärmeübergangswiderstände zu den angrenzenden Luftschichten. Der Wärmedurchgangskoeffizient wird in W/m²K angegeben. Er gibt den Wärmeverlust an, der pro Fläche durch ein Bauteil bei einer bestimmten Temperaturdifferenz. Je kleiner der Wert, desto besser dämmt z.B. der Wandaufbau.
-
Weiße Wanne
Wasserundurchlässiges Bauwerk, bei dem wasserundurchlässiger Beton (WU) zur Anwendung kommt, was zusätzliche Abdichtungsarbeiten unnötig macht. Weiße Wannen werden bei drückendem Grundwasser angewendet und in weiteren Anwendungsbereichen, welche die Eigenschaften der Weißen Wanne voraussetzen.
-
Werkvertrag
Privatrechtlicher Vertrag, bei dem sich ein Vertragspartner verpflichtet, eine Leistung gegen Bezahlung für einen anderen Vertragspartner zu erbringen.
-
Wirtschaftlichkeit
Analyse über das Kosten- Nutzen- Verhältnis. Liegt der Nutzen über den Kosten, ist die Wirtschaftlichkeit gegeben.
-
WU-Beton
Wasserundurchlässiger Beton, der einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Wasser in den Beton aufweist
X
-
XPS
Extrudierter Polystyrol Hartschaum, umgangssprachlich Styrodur genannt; besteht aus geschmolzenem und gepresstem Polystyrol, dadurch erhält es eine höhere Festigkeit als die expandierte Dämmschicht (EPS). XPS hat eine feinporige Struktur und damit eine geringere Wasseraufnahme; geeignet z.B. für unterirdische Fassadendämmung/ Perimeterdämmung
Y
-
Ytong
Z
-
Zellulose Dämmung
Natürliche Dämmung aus Zellulose, die aus Altpapier, Holz, Hanf, u.ä. gewonnen wird. Die Zellulose wird in die Außenwand- Zwischenräume eingeblasen und trägt zur Wärmedämmung sowie zum Schallschutz bei.

-
Zentrale Staubsaugeranlage
Zentral installiertes System, bestehend aus der stationären Saugeinheit (meist im Keller), den Unterputz verlegten Rohrleitungen und den in den verschiedenen Bereichen des Gebäudes vorgesehenen Anschluss- und Kehrdosen.
-
Ziegel
Künstlich hergestellter Baustein, der in unterschiedlichen Formen vorkommt (z.B. Lochziegel, Vollziegel, Planziegel, Dachziegel, usw.). Sie werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt (z.B. Ton, Beton, Lehm und Leichtbeton)
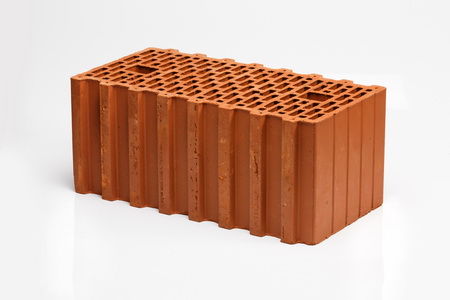
-
Zinsen
Entgelt, das der Kreditnehmer der Bank für geliehenes Kapital zahlt. Die Höhe der Zinsen hängt von der Dauer der Leihgabe und dem Zinssatz ab, der zwischen Kreditnehmer und Bank verhandelt wird.
-
zweischaliges Mauerwerk
Wandkonstruktion, bestehend aus zwei Mauerwerken oder einer Stahlbetonwand und einem Mauerwerk, zum Zwecke der Schalldämmung oder, um die Dämmeigenschaft einer Außenwand mit äußerem Sichtmauerwerk gewährleisten zu können.

-
Zwischensparrendämmung
Verlegung des Dämmstoffes in den Sparrenlagen (zwischen den Sparren). Der gesamte Dachaufbau lässt sich schlanker ausführen und die Zwischensparrendämmung lässt sich nachträglich von unten einbauen (z.B. als Sanierungsmaßnahme). Nachteil ist die entstehende Wärmebrücke im Bereich der Sparren, durch die Trennung der Dämmung, da Holz eine schlechtere Wärmedämmeigenschaft als Dämmstoffe hat.
-
Zyklopenmauerwerk
Mauerwerk aus großen, trocken verlegten Natursteinblöcken